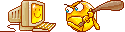Forscher arbeiten an Maschinen, sie sich selbst erfinden-
mithilfe von "evolutionärer" Software. Sie bedienen sich derselben Prozesse wie die Natur - könnte das freie Spiel der Kräfte dem Menschen
eines Tages gefährlich werden?
von: Steffan Heuer
Mit ferngesteuerten Sonden in Kleinlastergrösse nach Leben auf dem Mars zu suchen, das war gestern. Kenneth Zick von der Universität Michigan verfolg
für die Zukunft eine radikale andere Strategie. Der Computerwissenschaftler will quasi das Leben selbst auf den roten Planeten bringen:
in Form eines Schwarms intelligenter Maschinen, die jeden Tag etwas dazu lernen und selbstständig Entscheidungen treffen - so als wären wir selbst vor Ort.
"Meine Roboter sind billig, schnell und unkontrollierbar", scherzt der Tüftler. Er nennt sie "Tumbleweeds" (Steppenläufer) - nach einer in Amerika
heimischen Buschpflanze, die vom Wind durch die Prärie geweht wird. Wie die Steppenläufer sollen sich auch Zicks kugelförmigen Roboter vom Marswind
treiben lassen, um die Oberfläche des Planeten zu erkunden.
Das Besondere an den rund 10 Kilogramm schweren Maschinen mit 2 Meter Durchmesser ist ihr Innenleben:
In jeder von ihnen spielt sich eine Art elektronische Evolution ab - ein darwinistischer Wettlauf von immer neuen Kombinationen aus Hardware und Software.
Mit anderen Worten:
Die Roboter entwickeln sich weiter, um sich für das harte Marsklima zu stählen und sich für ihre Streifzüge zu optimieren.
So sollen sie etwa lernen, Schäden selbstständig zu reparieren - ganz ohne Hilfe einer Bodenstation.
"Genetische Programme" nennen Experten solche Software, die von Generation zu Generation immer komplexere Systeme hervorbringen.
Das Prinzip ähnelt jehnem der natürlichen Evolution. Mit einem wichtigem Unterschied:
Wärend es in der biologischen Umwelt Jahrmilliarden dauert, bis aus Einzellen in der Ursuppe die heutige Flora und Fauna wurde, können immer
leistungsfähigere Computer in wenigen Tagen Abermillionen von Programmen ausbrüten, kreuzen, mutieren
und die untauglichen Exemplare aussterben lassen.
Genetische Programme haben bereits neuartige Computerprogramme hervorgebracht.
Doch den Forschern geht es um weit mehr:
Sie sind dem Geheimnis des menschlichen Denkens auf der Spur - und womöglich einem Grundgesetz des ganzen Kosmos.
Kann aus evolutionären Programmen eine Maschine entstehen, die ihrem menschlichen Schöpfer in Geist und Fähigkeiten ebenbürdig oder sogar überlegen ist?
Ist der Darwin`sche Evolutionsmechanismus ein universales Prinzip, das jedem komplexen und intelligenten Verhalten im Kosmos zugrunde liegt?
Und was würde das für unsere eigene Rolle im grossen Entwicklungsprozess der Natur bedeuten?
Die Suche nach künstlicher Intelligenz begann vor mehr als einem halben Jahrhundert.
Der britische Mathematiker Alan Turing formulierte 1950 bis heute von der Fachwelt akzeptierte Kriterien für wahrhaft intelligente Maschinen:
Dem sogenannten Turing-Test.
Demnach besitzt ein Computer Erkenntnisvermögen, wenn ein menschlicher Beobachter im Blindtest nicht zu entscheiden vermag, ob er es auf
der anderen Seite der Wand mit einem Menschen oder mit einer Maschine zu tun hat. Turing selbst sah drei Möglichkeiten, wie sich denkende
Maschinen entwickeln könnten.
Erstens durch schiere Rechenkraft - also immer grössere und schnellere Supercomputer, aus deren Rechenleistung quasi automatisch
höhere Funktionen entstehen würden.
Zweitens schwebte ihm vor, bereits vorhandenes Wissen in Datenbanken einzuspeisen - eine Vorahnung der so genannten Expertensysteme.
Am spektakulärsten war allerdings der dritte Weg:
die Suche nach Möglichkeiten, die Entwicklung künstlicher Intelligenz nach Darwins Evolutionsprinzip ablaufen zu lassen.
Diesem Ziel hat sich John Koza verschrieben.
Der 63 Jahre alte Computerwissenschaftler an der Universität Stanford gilt als einer der Pioniere der genetischen Programmierung.
Ausserhalb der Fachwelt hat kaum jemand bemerkt, dass er als erster eine "denkende Maschine" entwickelt hat,
die in gewisser Weise den Kriterien des Turing-Tests bereits heute genügt.
Seit 2005 erhilt Koza zwei US-Patente für elektronische Steuerschaltkreise - doch erfunden hat nich er sie, sondern seine Maschine.
"Das Patentamt führt solche überprüfungen seit mehr als 200 Jahren durch, und nur wenige bestehen diesen Test" sagt Koza mit
sichlichem Stolz.
Und wenn das Amt nicht merke, dass eine Maschine der Erfinder sei, dann könnte man das
"durchaus als eine Art Turing-Test ansehen".
Zuvor hatte Kozas Maschine bereits über 20 Erfindungen repliziert, also "nacherfunden" - darunter neben Schaltkreisen auch
optische Systeme, Linsen und Antennen.
Das Herzstück der schlauen Maschine ist ein Cluster aus 1000 herkömmlichen Computern, die auf langen Regalreihen in einem unscheinbaren Rechenzentrum
im kalifornischen Silicon Valley untergebracht sind. Koza steuert das Spiel des Lebens von einem kleinen Büro aus, das er für seine Firma Genetic Programming
über einem örtlichen Fernsehstudio angemietet hat.
Die Prozedur funktioniert ganz nach den Drwin?schen Evolutionsprinzipien - bloss arbeitet man mit Computeralgorithmen statt mit Gensequenzen.
Den Anfang macht eine "Ursuppe" aus zufallsabhängig erzeugten Programmen. Sie arbeiten autonom - nur ihr Zweck ist definiert:
Beispielsweise sollen sie den Entwurf für eine neue Antenne liefern. Jede Software hat nun die Chance,
das gestellte Problem zu lösen. Aber nur die tauglischten Programme werden sich dabei durchsetzen, die untauglichen sterben aus - wie bei der
natürlichen Auslese.
"Da wir aber nich zu elitär sein wollen, lassen wir in jeder Generation auch Programme überleben, die nicht an der Spitze liegen. Das sorgt für nötige
Vielfalt", erklärt Lee Jones, einer von Kozas Mitarbeitern, während er auf seinem Bildschirm die Jahrgangsbesten einer Software
für eine neue Antenne begutachtet. Das Ergebnis ist noch suboptimal:
Nach gerademal drei Generationen erreicht keiner der Entwürfe auch nur annähernd die Leistung von bereits auf dem Markt
befindlichen Antennen. Mitunter braucht es mehrere zehntausend oder sogar Millionen Generationen, bis sich ein individuelles Programm durchgesetzt hat -
das bedeutet für Kozas Supercomputer eine Rechenzeit von einem Tag bis zu einem Monat.
Kein Wunder, dass Kozas Stromrechnung in manchen Monaten bei 3000 Dollar liegt!
Um immer besser zu werden, bedient sich genetische Software derselben Prozesse wie die Natur - dabei entsprechen die Bits den Genen,
die Programme den Chromosomen.
Da die Programme synchron laufen, können sie sich "paaren" - und dabei "vermischen" (rekombinieren) sich die Bits der jeweiligen elterlichen Software.
Ebenso kann beispilsweise ein Bit 0 durch ein Bit 1 erstzt werden (Mutation); auch exakte Kopien (Klone) können entstehen.
All dies funktioniert nach dem natürlichen Vorbild der sexuellen Reproduktion - eien höchst effiziente, weil zufällige Suche nach immer neuen,
besser angepassten Individuen in einer unentlichen "Evolutionslandschaft".
Auch der Selektionsdruck, den sonst Nahrungsmittel, Klima, Feinde, Seuchen oder andere Umweltbedingungen ausüben,
lässt sich simulieren. Er entsteht in Kozas Maschine durch so genannte Fitness-Parameter.
"Entscheident ist, dass genetische Programme genauso wie die natürliche Evolution keine vorgegebenen Logik folgen und kein vorgegebenes Wissen
über das Ziel besitzen, auf das sie zusteuern",
erklärt der Computerexperte.
Das ist der grosse Unterschied zu den meisten anderen Spielarten der künstlichen Intelligenz, die "deterministisch" angelegt sind:
sie arbeiten in definierten Schritten auf ein vorgegebenes Ziel hin - etwa beim PC-Spiel.
In Kozas Maschine herst das freie Spiel der Kräfte - der Mensch greift als "Schöpfer" nur dadurch ein, das er die elektronische Evolution nach
vielen Genarationen abbricht und sich anschaut, welche Programme sich als die besten erwiesen haben.
Legt man die Jahr für Jahr expoentiell wachsende Rechnerleistung zugrunde, dürfte genetische Software schon in wenigen Jahren
komerziell verwertbare Erfindungen ausspucken - etwa leistungfähigere Chips für die Fahrzeug- oder Unterhaltungselektronik oder Methoden
zur Herstellung künstlicher Moleküle und Proteine für neue Medikamente.
Damit liessen sich Ingenieure und andere Experten in den Entwicklungsabteilungen von Unternehmen bald durch Maschinen ergänzen oder ersetzen.
Ein herkömlicher Laptop kann heute bereits in einer einzigen Woche alle jene Patente nacherfinden, für die Koza in den 1990er Jahren
noch mehrere Wochen brauchte. Die von seiner Denkenden Maschine ersonnenen elektronischen Steuerungsschaltkreise benötigen einen Monat
Evolutionszeit. Schon in einem Jahrzehnt könnte eine derart komplexe Erfindung der mathematischen Ursuppe binnen sieben Stunden entsteigen.
"Genetische Programme sind keine spilerei mehr. Sie werden von vielen Firmen eingesetzt, um handfeste Probleme zu lösen", sagt David Goldberg,
Professor für Ingenieurwissenschaften an der University of Illinois.
"Unternehmen hängen das nur nicht an dei grosse Glocke, weil es vielen Menschen unheimlich erscheint, dass eine Maschine bessere Antworten findet als Experten."
Als Beispiele nennt er Ingenious Software von General Electric, die auf diese Weise neue Flugzeug-Triebwerke entwickelt,
oder Finanzfirmen wie First Quadrant, die mithilfe genetischer Algorithmen Investitionsentscheidungen treffen.
Goldberg sorgte vor kurzem für Aufsehen, als er zum ersten Mal ein genetisches Programm vorführte, das Operationen mit einer Milliarde Variablen bewältigt.
"Damit lassen sich so komplexe Systeme wie das Weltweite Streckennetz einer Fluggesellschaft planen und verwalten", sagt der Forscher.
"Wir können heute den kretiven Prozess eines Menschen bereits in einer Maschine nachahmen, obwohl das einem kaum jemand glauben will."
Doch die Forscher gehen noch weiter:
Sie arbeiten bereits an evolutionären Maschinen, die nicht nur ihre Software, sondern auch ihre Hardware autonom weiterentwickeln und perfektionieren.
Bereits heute lassen sich Mikrochips wie Software umkonfigurieren. Die Marsroboter von Kenneth Zick beispielsweise enthalten Prozessoren, die ihre eigenen
Schaltkreise verändern können und somit eine Plastizität wie das menschliche Gehirn aufweiden. Im Gegensatz zum herkömmlichen Transistor,
der nur die digitalen Signale 0 und 1 versteht, kann evolutionäre Hardware graduell auf Umweltsignale reagieren und so etwa ausgefallene Schaltkreise
umgehen oder sogar Verbindungen schaffen, um neue Aufgaben zu bewältigen.
àhnlich entwickeln sich die Hirnfunktionen:
durch die Bildung neuer und das Verstärken oder Kappen alter Verbindungen zwischen Nervenzellen.
Zick will zehn Prozent der Rechenleistung in jedem "Steppenläufer" für genetische Programme reservieren, die mit immer neuen Schaltkreisen dafür sorgen,
das möglichst keiner der Erkundungsroboter ausfällt.
Zumindest im Labor gibt es bereits Roboter, die eine Vorstellung von ihrem Körper besitzen, sich der Umgebung anpassen und sogar selber reparieren,
wenn etwa eines ihrer Beine beschädigt wird.
Ein von US-Forschern entwickelter Roboter lernt seine Gestallt anhand von mehreren Software-Modellen kennen, die sich je nach seinen Bewegungsmöglichkeiten
ändern - ähnlich wie ein tapsiges Neugeborenes die Welt erkundet.
Eine "Super-Bot" genannte lernfähige Maschine, die Forscher an der University of Southern California in LA gebaut haben, kann sich jeh nach Umgebung
umkonfigurieren - etwa zum Rad, zur Raupe oder zum aufrecht gehenden Roboter.
Wissenschaftler an der Stanford University und der University of Pennsylvania schliesslich arbeiten an einem rekonfigurierbaren Chip zur optischen
Erkennung: Er ist dem visiuellen Kodex des Menschen nachempfunden und soll mit der Zeit das Sehen lernen.
Der Mensch als entwicklungsfähigtes Sofware-Hardware-Bündel ist für die genetischen Programmierer immer noch das beste Vorbild.
Das jedenfalls sagt der Vater der gesamten Disziplin, John Holland von der University of Michigan.
Er entwickelte Anfang der 1970er Jahre die ersten genetischen Algorithmen, heute erforscht der 78 Jährige, wie man Robotern Lernen bebringen kann.
"Der Turing-Test bewertet nur die Antworten einer Maschine, aber nicht ihre Lernfähigkeit", sagt er.
"Wir werden nur vorankommen, wenn wir Hardware und Software haben, die in Echtzeit auf den Input Ihrer Umgebung reagieren - also die Situation verstehen,
in der sie sich befinden."
Holland sucht deswegen nach Computermodellen, die lernen, wie der Mensch eine Sprache lernt: vom Gebrabbel eines Babys über die ersten Worte bis zu kompletten Sätzen.
Entscheident ist dabei, dass der Roboter möglichst viel an verbaler Inspiration aufnehmen und verarbeiten kann.
In der plastischen Erkenntnisfähigkeit liegt für Holland wie für seinen Schüler Goldberg der Schlüssel zur waren Kreativität der Maschinen von morgen.
Genetische Programme sind nur eine Zwischenlösung, denn sie besitzen bislang keinen Sinn für das Drumherum und laufen mit Scheuklappen solange ab,
bis wir die beste Software aus der Maschine "ernten".
Der Mensch kann beispielsweise Ideen aus dem Theaterstück von gestern Abend oder ein Gespräch vor zwei Jahren verwerten, um einen Gedankeblitz für ein unerhörtes
medizintechnisches Gerät zu zünden. Genetische Programme, das gibt selbst ihr Erfinder John Koza zu,
leisten das nur in Ansätzen.
Sie können im Gegensatz zum Menschen weder selbst die Ausgangsfrage stellen und nach Antworten suchen, geschweige den eine Frage ferfeinern oder umformulieren,
wenn neue Erkenntnise hinzukommen.
"Wenn wir wirklich kreative Maschinen wollen", denkt Goldberg laut nach, "sollten wir ihnen dann nicht auch die Kontrolle überlassen?
Wir könnten uns darauf beschränken, ein künstliches Bewusstsein entstehen zu lassen oder zumindest künstlich geschaffene Absichten als Motivation
zum Handeln anzuspeisen."
Wie man zu dieser nächsten Phase der Maschinen-Evolution gelangt, ist unter Experten der Künstlichen Intelligenz und der Robotik eine leidenschaftlich diskutierte Frage.
Sie halten es aber durchaus für möglich, dass sich selbst aus den einfachsten Ausgangsbedingungen und einigen simplen Regeln komplexe Verhaltensmuster entwickeln -
und letzten Endes Intelligenz.
Die Chance dafür stehen nicht schlecht, denn evolutionäre Prozesse könnten die Grundlage für alles komplexe und intelligente Verhalten im Universum sein.
Wenn das All und alles Leben darin nichts weiter als ein gigantisches Programm wäre, das seit Jahrmilliarden läuft, würde es die Entwicklung vom Samenkorn
zum Baum ebenso codieren wie die Evolution des Menschen - oder eben den Weg vom digitalen Schaltkreis zum modernen Supercomputer mit Bewusstsein.
Sicher müsste unsere Gattung dann ein weiteres Mal zur Kenntnis nehmen, dass sie nicht die Krone, sondern ein Teil der Schöpfung ist.
Aber ein Grund zum Verzweifeln wäre es auch nicht.
Quell:
PM-Magazin
Ausgabe 12/2007