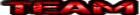Am 26. Januar 2016 kündigte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eine regelrechte Rüstungsoffensive an: Bis 2030 sollen üppige 130 Mrd. Euro in die Neuanschaffung von Rüstungsgütern gesteckt werden. Am folgenden Tag wurde dann dem Verteidigungsausschuss eine Liste mit Beschaffungsvorhaben vorgelegt, die anscheinend überwiegend auf Zustimmung stieß – auch und gerade Finanzminister Wolfgang Schäuble signalisierte dem Vernehmen nach sein Wohlwollen. Dies ist auch dringend erforderlich, denn ins Auge gefasst wird nahezu eine Verdopplung der bisherigen Rüstungsinvestitionen, was zwingend einen – erneuten – spürbaren Aufwuchs des Rüstungsetats erfordern wird.
Überraschend kam die Initiative allerdings nicht, sie war von langer Hand geplant: Schon seit Jahren jammern Politik, Militär und Industrie, die Bundeswehr benötige eine kräftige Finanzspritze. Zuletzt wurden noch unmittelbar vor von der Leyens Auftritt sowohl der SPD-Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels wie auch der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes André Wüstner öffentlichkeitswirksam ins Feld geschickt, um Alarm zu schlagen. Die Bundeswehr sei ein „Sanierungsfall“, so Wüstner[1], dem Bartels sekundierte, die Truppe wäre „am Limit“[2], weshalb eine erneute Erhöhung des Rüstungsetats erforderlich sei: „Das muss weitergehen“.[3]
Der jüngsten Initiative ging also eine sorgfältig orchestrierte Propagandaoffensive voraus, die den Nährboden für von der Leyens ambitionierte Forderungen bereitete. Die Karten müssten „klar auf den Tisch“, betonte die Verteidigungsministerin und löste diesen Anspruch auch durchaus ein: denn sie sprach nicht nur die Notwendigkeit an, mehr Rüstungsgüter anzuschaffen und demzufolge dauerhaft deutlich mehr Geld in die Hand zu nehmen. Sie räumte auch offen ein, dies sei zwingend erforderlich, schließlich könne Deutschland nur so gemäß seiner „politischen und ökonomischen Bedeutung“ militärisch auf der Weltbühne agieren.[4]
Schrotthaufen-Debatte als Wegbereiter
In den letzten Jahren jagte eine Pannenserie die nächste – praktisch kein Bundeswehr-Beschaffungsprojekt kam ohne drastische Verzögerungen und teils regelrecht absurde Preiserhöhungen über die Ziellinie. Vor diesem Hintergrund zog Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Februar 2014 öffentlichkeitswirksam die Notbremse. Als Hauptverantwortlichen für die Misere identifizierte sie den Staatssekretär für Ausrüstung, Stéphane Beemelmans, der von seinen Aufgaben entbunden – sprich: gefeuert – wurde, und seinen Abteilungsleiter, Detlef Selhausen, den man kurzerhand versetzte.
Im selben Atemzug kündigte von der Leyen auch eine externe Überprüfung der Bundeswehr-Großprojekte an. Mit dieser Aufgabe wurden die Unternehmensberatung KPMG, die Ingenieurgesellschaft P3 und die Kanzlei Taylor Wessing betraut, die ihre Ergebnisse in Form des Gutachtens „Bestandsaufnahme und Risikoanalyse zentraler Rüstungsprojekte“ am 6. Oktober 2014 an die Verteidigungsministerin übergaben. Darin wurden auf 1.200 Seiten, von denen allerdings nur ein 51-seitiges Exzerpt öffentlich einsehbar ist, neun Großprojekte mit einem Gesamtvolumen von 57 Mrd. Euro untersucht, wobei 140 Probleme und Risiken identifiziert wurden. Das Gutachten mahnte aus diesem Grund an, „dass eine Optimierung des Rüstungsmanagements in nationalen und internationalen Großprojekten dringend und ohne Verzug geboten ist“.[5] Auch das Fazit der neuen Staatssekretärin für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, Katrin Suder, fiel vernichtend aus: „Waffensysteme kommen um Jahre zu spät, Milliarden teurer als geplant – und dann funktionieren sie oft nicht richtig oder haben Mängel.“[6]
Obwohl durchaus auch die Industrie hier als Teil des Problems identifiziert wurde, nahm diese das Gutachten auffällig positiv auf. Allerdings wird aus der Pressemitteilung zum Gutachten der beiden größten Rüstungslobbyverbände schnell ersichtlich, weshalb dies der Fall war: „Die Studie bestätigt die Notwendigkeit der industrieseitig bereits seit längerem angemahnten ausreichenden Mittelbereitstellung.“[7] Von diesem Zeitpunkt an wurde die Botschaft, die Bundeswehr sei finanziell unterversorgt, sodass dringender Handlungsbedarf bestehe, mit nochmals verstärkter Vehemenz in die Öffentlichkeit getragen. Unmittelbar nach Veröffentlichung des Rüstungsprojekte-Gutachtens setzte in der Presse ein, was man als „Schrotthaufen-Debatte“ bezeichnen könnte: „So Schrott ist die Bundeswehr“ (Bild[8]), die Truppe sei nichts anderes als „stahlgewordener Pazifismus“ (Die Zeit[9]) und das ganze Problem existiere vor allem, da die Bundeswehr seit Jahren „Chronisch unterfinanziert“ (Deutschlandfunk[10]) sei. Damit war vor allem eins erreicht: ein gewisser Nährboden war geschaffen, um die Akzeptanz in der ansonsten gegenüber einer Erhöhung der Rüstungsausgaben eher kritischen Bevölkerung zu vergrößern.
Rüstungsagenda-Setting
Die von Verteidigungsministerin von der Leyen zeitgleich mit der Veröffentlichung des Beschaffungsprojekte-Gutachtens ins Leben gerufene „Agenda Rüstung“ benennt vor allem die „Optimierung im Management der Rüstungsprojekte“ sowie die „Schließung von Fähigkeitslücken“ als wesentliche Aufgaben der kommenden Jahre.[11] Um diese Vorhaben zu konkretisieren, wurde in der Folgezeit eine Reihe von Papieren erstellt: Die Beschaffungsprojekte sollen nun in regelmäßigen Abständen in ausführlichen Berichten unter die Lupe genommen werden, was zu einer Verringerung der Risiken und damit der Kosten beitragen soll. Daneben zielt das „Strategiepapier der Bundesregierung zur Stärkung der Verteidigungsindustrie in Deutschland“, das im Juli 2015 veröffentlicht wurde, vor allem auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und damit der Exportchancen der deutschen Industrie ab.[12]
Bereits kurz zuvor, im Juni 2015, und im Zusammenhang mit den jüngsten Ankündigungen der Verteidigungsministerin von besonderem Interesse, wurde das „Dialogpapier“ der Öffentlichkeit präsentiert. Es enthält die Ergebnisse des Dialogkreises, in dem sich seit November 2014 nicht weniger als 70 Vertreter aus Reihen des Verteidigungsministeriums und der Rüstungsindustrie mit Rüstungsfragen befassten. Nachdem es sich bei dem Rüstungsprojekte-Gutachten um eine „nach innen gerichtete Bestandsaufnahme“ gehandelt habe, sei nun das „konstruktive Gespräch mit der Industrie“ gesucht worden, um zu einem „gemeinsamen Verständnis“ über die „Agenda Rüstung“ zu gelangen und „Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation zu suchen.“[13]
Im Dialogpapier wird zwar durchaus die Notwendigkeit angedeutet, die Rüstungsindustrie künftig stärker darauf zu verpflichten, auch auftragsgemäß zu liefern – konkrete Maßnahmen in diese Richtung sind allerdings kaum zu finden, alles bleibt diesbezüglich relativ vage. Sehr detailliert wurde das Dialogpapier dagegen, was die Vorstellungen für den Finanzbereich anbelangt: Klipp und klar wird festgehalten, es bestehe weiterhin die „Notwendigkeit einer graduellen Erhöhung des Einzelplans 14 und seines investiven Anteils.“ Der mit dem Eckwerte-Papier im Frühjahr 2015 bereits beschlossene Aufwuchs des Rüstungshaushaltes sei zwar begrüßenswert, aber keineswegs ausreichend: „Dieser Anstieg ist jedoch zu schwach.“[14]
Neben der Erhöhung der Militärausgaben im Allgemeinen widmet sich das Dialogpapier auch der Frage der Rüstungsinvestitionen, die momentan bei etwa 15% des Militärhaushalts liegen und ebenfalls deutlich steigen sollen: „Als konkrete Maßnahmen werden die aufgaben- und ausrüstungsorientierte Erhöhung des Einzelplans 14, die Festschreibung einer Investitionsquote von 20 Prozent für Rüstungsinvestitionen und die Festschreibung einer F&T-Quote von 10 Prozent des Investivanteils im Einzelplan 14 empfohlen.“[15]
Unmittelbar darauf konnten bereits erste „Erfolge“ vermeldet werden: Schon für das Haushaltsjahr 2015 sind für Militärische Beschaffung (4,2 Mrd. Euro) und Materialerhaltung (2,76 Mrd. Euro) sowie für Forschung & Entwicklung (802 Mio. Euro) signifikante Steigerungen zu verzeichnen. Mehr noch: vor allem der Investitionsetat wird gemäß aktueller Planungen bis 2019 im Vergleich zu 2014 um knapp 35 Prozent deutlich ansteigen (siehe Tabelle). Insofern berichtete das BMVg im Oktober 2015 in seinem Bericht an das Parlament zufrieden: „Mit dem Regierungsentwurf zum Haushalt 2016/49. Finanzplan ist es gelungen, die Voraussetzungen zur Steigerung der Rüstungsinvestitions-Quote zu schaffen und insofern eine Trendwende einzuleiten.“[16]
Die Forderung nach einer – deutlichen – Erhöhung der Rüstungsinvestitionen lag also bereits einige Zeit vor von der Leyens Ankündigung im Januar 2016 auf dem Tisch und sollte deshalb nicht sonderlich überraschen. Was daran allerdings überrascht, ist, dass die Ministerin nochmal erheblich über die im „Dialogpapier“ geforderten Erhöhungen hinausging.
Kostspielige Beschaffungsoffensive
Viele der aktuellen Bundeswehr-Großprojekte befinden sich kurz vor ihrem Abschluss, allerdings steht die nächste „Waffengeneration“ bereits in den Startlöchern. Dazu gehören schon seit einiger Zeit die sogenannten „Big-3“, die wohl besonders kostspielig werden dürften: das „Taktische Luftverteidigungssystem“ (TLV), das „Mehrzweckkampschiff“ (TKS) sowie das „Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial System“ („Male-Drohne“). Doch auch darüber hinaus wurde eine umfassende Liste mit Beschaffungsvorhaben vorgelegt, die mit der jüngsten Initiative der Verteidigungsministerin Ende Januar 2016 noch einmal substanziell erweitert wurde: „Beschaffen will das Verteidigungsministerium demnach zusätzliche Fahrzeuge, Schiffe und Flieger für die verschiedensten Zwecke. So soll der Bestand an Fennek-Spähpanzern um 30 auf dann 248 steigen. Statt 89 soll es 101 Panzerhaubitzen geben. Außerdem sollen sechs Marine-Helikopter zusätzlich angeschafft werden und 40 schwere Transporthubschrauber als Ersatz für die alten CH53-Maschinen. Für einen internationalen Hubschrauberverbund kommen nochmal 22 NH90-Helikopter dazu. Schon vor neun Monaten verkündete die Ministerin den Rückkauf von 100 ausgemusterten Leopard2-Kampfpanzern, die eigentlich schon zur Verwertung an die Industrie abgegeben waren. Ihre Gesamtzahl soll demnach von maximal 225 auf 320 steigen. Ebenfalls bereits verkündet ist der Kauf von zusätzlich 130 Radpanzern Typ Boxer. Mit ihnen würde die Zahl der Fahrzeuge in dieser Klasse auf 1300 steigen. Überlegt wird außerdem, fast 200 der bereits ziemlich betagten Schützenpanzer Marder, die eigentlich vom Nachfolger Puma abgelöst werden sollten, weiter in der Truppe zu nutzen.“[17]
Selbstverständlich sind diese Kriegsgeräte nicht zum Nulltarif zu haben: Bis 2030 seien Investitionen im Gesamtvolumen von 130 Mrd. erforderlich, so von der Leyen. Legt man die bisher bis 2019 eingestellten Summen zugrunde, bedeutet dies zusätzliche Anschaffungen im Umfang von etwa 50 Mrd. Euro. Dies würde einem jährlichen Investitionsetat von ca. 9 Mrd. Euro jährlich entsprechen – die Rüstungsinvestitionen sollen also fast verdoppelt werden![18] Selbst wenn es gelänge, die Rüstungsinvestitionsquote, wie im Dialogpapier anvisiert, auf 20 Prozent zu erhöhen – was im Übrigen angesichts der möglichen Wiederaufstockung der Truppenzahl und den wachsenden Rekrutierungskosten recht fraglich ist –, würde das bei weitem nicht ausreichen, um den nun artikulierten Bedarf zu decken. Es liegt also auf der Hand, dass hier mehr oder weniger offen eine – nochmalige – Erhöhung des Rüstungsetats auf den Weg gebracht wird. Da trifft es sich aus von der Leyens Sicht besonders gut, dass ihr zufolge Finanzminister Wolfgang Schäuble „große Offenheit“ gegenüber ihren Forderungen an den Tag gelegt haben soll.[19]
Rüstungshaushalt: Schluck aus der Finanzpulle
Es lässt einen einigermaßen fassungslos zurück, wenn von der Leyen ihre jüngste Rüstungsoffensive u.a. damit begründet, der „große Nachholbedarf“ bei der Bundeswehr-Finanzierung müsse behoben werden.[20] Hier stellt sich doch ernsthaft die Frage, von was die Verteidigungsministerin spricht. Denn ungeachtet des seitens von Politik, Militär und Rüstungsindustrie sorgsam gepflegten Bildes einer drastisch unterfinanzierten Bundeswehr, sieht die Realität gänzlich anders aus.
Fakt ist: der Militärhaushalt stieg von (umgerechnet) 23,18 Mrd. Euro im Jahr 2000 selbst inflationsbereinigt um nahezu 25 Prozent auf etwa 33 Mrd. im Jahr 2015 an. Damit liegt der Haushalt zudem drastisch über dem – eigentlich verbindlich – vereinbarten Sparziel vom Juni 2010. Damals war festgelegt worden, dass alle Resorts bis 2014 zusammen 81,6 Mrd. Euro einsparen müssen und die Bundeswehr dazu 8,3 Mrd. Euro beitragen soll. Gemäß dem daran angelegten Bundeswehrplan sollte hierfür der Rüstungshaushalt bis 2014 auf 27,6 Mrd. Euro reduziert werden. Ganz offensichtlich wurde dieser Beschluss in der Folge dann stillschweigend kassiert. Obwohl also der offizielle Haushalt 2015 etwa 5,5 Mrd. über dem vereinbarten Sparziel lag, legte Finanzminister Wolfgang Schäuble im Frühjahr 2015 mit dem „Eckwerte-Papier“ noch einmal nach. Demnach soll der Etat 2016 auf 34,2 Mrd. Euro steigen, im Jahr darauf sollen es 34,74 Mrd. und 2018 dann 34,8 Mrd. sein, um 2019 schließlich 35 Mrd. zu umfassen.[21] Da nun scheinbar dennoch eine nochmalige Erhöhung ins Haus steht, drängt sich natürlich die Frage auf, wofür diese Kapazitäten für notwendig gehalten werden.
Kriegerische Verantwortung
Ganz den Schuh zieht es einem dann schlussendlich aus, dass von der Leyen ihre Rüstungsoffensive auch noch nassforsch damit begründet, sie sei erforderlich, damit Deutschland seiner „Verantwortung“ in der Welt gerecht werden könne; mit jenem Schlagwort also, das in jüngster Zeit zu einer kaum mehr verklausulierten Umschreibung für deutsche Weltmachtansprüche geworden ist: „Es ist klar für Alle, dass wenn wir äußere Sicherheit haben wollen und die derzeitige Lage zeigt, dass wenn Deutschland sicher sein soll, innerhalb der Bündnisse, dann müssen wir unseren Anteil an Verantwortung auch tragen und tatsächlich unsere Pflichten auch leisten, es ist klar, dann müssen wir auch investieren. […] Es geht nicht darum, ein Jahr mal eben einen großen Schluck aus der Pulle zu haben, darum geht es nicht, sondern dass es ganz wichtig ist, dass der Verteidigungsetat steigt, aber dann langfristig stetig oben bleibt.“[22]
Anschließend stellte die Journalistin Christiane Meier angesichts von 17 Bundeswehr-Einsätzen weltweit „von der Westsahara bis Afghanistan“ die Frage: „Müssen wir uns wirklich so groß aufstellen“? Die Antwort der Ministerin fiel überaus entschieden aus: „Aber ja! Das ist die Folge von Globalisierung. Das ist die Folge auch eines Landes, das eine große Bedeutung hat, politisch und ökonomisch, und das Verantwortung tragen muss, aber auch tragen will. Wir lernen doch gerade in der Flüchtlingskrise, dass wenn wir uns nicht kümmern […], dann kommen die Probleme zu uns vor die Haustür. Wenn wir uns nicht kümmern um Syrien oder Irak oder Afghanistan, wenn wir uns nicht kümmern in Afrika […], wenn wir unseren Beitrag nicht leisten, dann kommen die Probleme zu uns und dann wird es noch schlimmer. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen unseren Teil an Verantwortung tragen, dafür muss die Truppe gut ausgerüstet sein.“[23]
Es sei „richtig, wenn man die Probleme am Ort selber bekämpft“, so von der Leyen weiter, das beinhalte, wenn man „Stabilisierung in den fragilen Ländern mit herstellt“. Weiter sei es „richtig für die Menschen, ihre Perspektive in der Heimat zu schaffen, anstatt dass wir dann Erscheinungen haben, wie wir sie im Augenblick bei dieser epochalen Flüchtlingskrise sehen.“[24] Dass das Militär herzlich wenig dazu beigetragen hat, die von der Ministerin benannten Probleme zu beheben und sie in vielen Fällen überhaupt erst (mit)verursacht hat, wird natürlich ausgespart. Womit Deutschland wirklich seiner Verantwortung in der Welt halbwegs gerecht werden könnte wäre, wenn es z.B. eine Entwicklungsagenda im Umfang von mindestens 130 Mrd. Euro vorlegen würde – doch derlei Überlegungen stehen selbstredend nicht auf der „Agenda Rüstung“.
QUELLE
Überraschend kam die Initiative allerdings nicht, sie war von langer Hand geplant: Schon seit Jahren jammern Politik, Militär und Industrie, die Bundeswehr benötige eine kräftige Finanzspritze. Zuletzt wurden noch unmittelbar vor von der Leyens Auftritt sowohl der SPD-Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels wie auch der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes André Wüstner öffentlichkeitswirksam ins Feld geschickt, um Alarm zu schlagen. Die Bundeswehr sei ein „Sanierungsfall“, so Wüstner[1], dem Bartels sekundierte, die Truppe wäre „am Limit“[2], weshalb eine erneute Erhöhung des Rüstungsetats erforderlich sei: „Das muss weitergehen“.[3]
Der jüngsten Initiative ging also eine sorgfältig orchestrierte Propagandaoffensive voraus, die den Nährboden für von der Leyens ambitionierte Forderungen bereitete. Die Karten müssten „klar auf den Tisch“, betonte die Verteidigungsministerin und löste diesen Anspruch auch durchaus ein: denn sie sprach nicht nur die Notwendigkeit an, mehr Rüstungsgüter anzuschaffen und demzufolge dauerhaft deutlich mehr Geld in die Hand zu nehmen. Sie räumte auch offen ein, dies sei zwingend erforderlich, schließlich könne Deutschland nur so gemäß seiner „politischen und ökonomischen Bedeutung“ militärisch auf der Weltbühne agieren.[4]
Schrotthaufen-Debatte als Wegbereiter
In den letzten Jahren jagte eine Pannenserie die nächste – praktisch kein Bundeswehr-Beschaffungsprojekt kam ohne drastische Verzögerungen und teils regelrecht absurde Preiserhöhungen über die Ziellinie. Vor diesem Hintergrund zog Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Februar 2014 öffentlichkeitswirksam die Notbremse. Als Hauptverantwortlichen für die Misere identifizierte sie den Staatssekretär für Ausrüstung, Stéphane Beemelmans, der von seinen Aufgaben entbunden – sprich: gefeuert – wurde, und seinen Abteilungsleiter, Detlef Selhausen, den man kurzerhand versetzte.
Im selben Atemzug kündigte von der Leyen auch eine externe Überprüfung der Bundeswehr-Großprojekte an. Mit dieser Aufgabe wurden die Unternehmensberatung KPMG, die Ingenieurgesellschaft P3 und die Kanzlei Taylor Wessing betraut, die ihre Ergebnisse in Form des Gutachtens „Bestandsaufnahme und Risikoanalyse zentraler Rüstungsprojekte“ am 6. Oktober 2014 an die Verteidigungsministerin übergaben. Darin wurden auf 1.200 Seiten, von denen allerdings nur ein 51-seitiges Exzerpt öffentlich einsehbar ist, neun Großprojekte mit einem Gesamtvolumen von 57 Mrd. Euro untersucht, wobei 140 Probleme und Risiken identifiziert wurden. Das Gutachten mahnte aus diesem Grund an, „dass eine Optimierung des Rüstungsmanagements in nationalen und internationalen Großprojekten dringend und ohne Verzug geboten ist“.[5] Auch das Fazit der neuen Staatssekretärin für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, Katrin Suder, fiel vernichtend aus: „Waffensysteme kommen um Jahre zu spät, Milliarden teurer als geplant – und dann funktionieren sie oft nicht richtig oder haben Mängel.“[6]
Obwohl durchaus auch die Industrie hier als Teil des Problems identifiziert wurde, nahm diese das Gutachten auffällig positiv auf. Allerdings wird aus der Pressemitteilung zum Gutachten der beiden größten Rüstungslobbyverbände schnell ersichtlich, weshalb dies der Fall war: „Die Studie bestätigt die Notwendigkeit der industrieseitig bereits seit längerem angemahnten ausreichenden Mittelbereitstellung.“[7] Von diesem Zeitpunkt an wurde die Botschaft, die Bundeswehr sei finanziell unterversorgt, sodass dringender Handlungsbedarf bestehe, mit nochmals verstärkter Vehemenz in die Öffentlichkeit getragen. Unmittelbar nach Veröffentlichung des Rüstungsprojekte-Gutachtens setzte in der Presse ein, was man als „Schrotthaufen-Debatte“ bezeichnen könnte: „So Schrott ist die Bundeswehr“ (Bild[8]), die Truppe sei nichts anderes als „stahlgewordener Pazifismus“ (Die Zeit[9]) und das ganze Problem existiere vor allem, da die Bundeswehr seit Jahren „Chronisch unterfinanziert“ (Deutschlandfunk[10]) sei. Damit war vor allem eins erreicht: ein gewisser Nährboden war geschaffen, um die Akzeptanz in der ansonsten gegenüber einer Erhöhung der Rüstungsausgaben eher kritischen Bevölkerung zu vergrößern.
Rüstungsagenda-Setting
Die von Verteidigungsministerin von der Leyen zeitgleich mit der Veröffentlichung des Beschaffungsprojekte-Gutachtens ins Leben gerufene „Agenda Rüstung“ benennt vor allem die „Optimierung im Management der Rüstungsprojekte“ sowie die „Schließung von Fähigkeitslücken“ als wesentliche Aufgaben der kommenden Jahre.[11] Um diese Vorhaben zu konkretisieren, wurde in der Folgezeit eine Reihe von Papieren erstellt: Die Beschaffungsprojekte sollen nun in regelmäßigen Abständen in ausführlichen Berichten unter die Lupe genommen werden, was zu einer Verringerung der Risiken und damit der Kosten beitragen soll. Daneben zielt das „Strategiepapier der Bundesregierung zur Stärkung der Verteidigungsindustrie in Deutschland“, das im Juli 2015 veröffentlicht wurde, vor allem auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und damit der Exportchancen der deutschen Industrie ab.[12]
Bereits kurz zuvor, im Juni 2015, und im Zusammenhang mit den jüngsten Ankündigungen der Verteidigungsministerin von besonderem Interesse, wurde das „Dialogpapier“ der Öffentlichkeit präsentiert. Es enthält die Ergebnisse des Dialogkreises, in dem sich seit November 2014 nicht weniger als 70 Vertreter aus Reihen des Verteidigungsministeriums und der Rüstungsindustrie mit Rüstungsfragen befassten. Nachdem es sich bei dem Rüstungsprojekte-Gutachten um eine „nach innen gerichtete Bestandsaufnahme“ gehandelt habe, sei nun das „konstruktive Gespräch mit der Industrie“ gesucht worden, um zu einem „gemeinsamen Verständnis“ über die „Agenda Rüstung“ zu gelangen und „Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation zu suchen.“[13]
Im Dialogpapier wird zwar durchaus die Notwendigkeit angedeutet, die Rüstungsindustrie künftig stärker darauf zu verpflichten, auch auftragsgemäß zu liefern – konkrete Maßnahmen in diese Richtung sind allerdings kaum zu finden, alles bleibt diesbezüglich relativ vage. Sehr detailliert wurde das Dialogpapier dagegen, was die Vorstellungen für den Finanzbereich anbelangt: Klipp und klar wird festgehalten, es bestehe weiterhin die „Notwendigkeit einer graduellen Erhöhung des Einzelplans 14 und seines investiven Anteils.“ Der mit dem Eckwerte-Papier im Frühjahr 2015 bereits beschlossene Aufwuchs des Rüstungshaushaltes sei zwar begrüßenswert, aber keineswegs ausreichend: „Dieser Anstieg ist jedoch zu schwach.“[14]
Neben der Erhöhung der Militärausgaben im Allgemeinen widmet sich das Dialogpapier auch der Frage der Rüstungsinvestitionen, die momentan bei etwa 15% des Militärhaushalts liegen und ebenfalls deutlich steigen sollen: „Als konkrete Maßnahmen werden die aufgaben- und ausrüstungsorientierte Erhöhung des Einzelplans 14, die Festschreibung einer Investitionsquote von 20 Prozent für Rüstungsinvestitionen und die Festschreibung einer F&T-Quote von 10 Prozent des Investivanteils im Einzelplan 14 empfohlen.“[15]
Unmittelbar darauf konnten bereits erste „Erfolge“ vermeldet werden: Schon für das Haushaltsjahr 2015 sind für Militärische Beschaffung (4,2 Mrd. Euro) und Materialerhaltung (2,76 Mrd. Euro) sowie für Forschung & Entwicklung (802 Mio. Euro) signifikante Steigerungen zu verzeichnen. Mehr noch: vor allem der Investitionsetat wird gemäß aktueller Planungen bis 2019 im Vergleich zu 2014 um knapp 35 Prozent deutlich ansteigen (siehe Tabelle). Insofern berichtete das BMVg im Oktober 2015 in seinem Bericht an das Parlament zufrieden: „Mit dem Regierungsentwurf zum Haushalt 2016/49. Finanzplan ist es gelungen, die Voraussetzungen zur Steigerung der Rüstungsinvestitions-Quote zu schaffen und insofern eine Trendwende einzuleiten.“[16]
Die Forderung nach einer – deutlichen – Erhöhung der Rüstungsinvestitionen lag also bereits einige Zeit vor von der Leyens Ankündigung im Januar 2016 auf dem Tisch und sollte deshalb nicht sonderlich überraschen. Was daran allerdings überrascht, ist, dass die Ministerin nochmal erheblich über die im „Dialogpapier“ geforderten Erhöhungen hinausging.
Kostspielige Beschaffungsoffensive
Viele der aktuellen Bundeswehr-Großprojekte befinden sich kurz vor ihrem Abschluss, allerdings steht die nächste „Waffengeneration“ bereits in den Startlöchern. Dazu gehören schon seit einiger Zeit die sogenannten „Big-3“, die wohl besonders kostspielig werden dürften: das „Taktische Luftverteidigungssystem“ (TLV), das „Mehrzweckkampschiff“ (TKS) sowie das „Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial System“ („Male-Drohne“). Doch auch darüber hinaus wurde eine umfassende Liste mit Beschaffungsvorhaben vorgelegt, die mit der jüngsten Initiative der Verteidigungsministerin Ende Januar 2016 noch einmal substanziell erweitert wurde: „Beschaffen will das Verteidigungsministerium demnach zusätzliche Fahrzeuge, Schiffe und Flieger für die verschiedensten Zwecke. So soll der Bestand an Fennek-Spähpanzern um 30 auf dann 248 steigen. Statt 89 soll es 101 Panzerhaubitzen geben. Außerdem sollen sechs Marine-Helikopter zusätzlich angeschafft werden und 40 schwere Transporthubschrauber als Ersatz für die alten CH53-Maschinen. Für einen internationalen Hubschrauberverbund kommen nochmal 22 NH90-Helikopter dazu. Schon vor neun Monaten verkündete die Ministerin den Rückkauf von 100 ausgemusterten Leopard2-Kampfpanzern, die eigentlich schon zur Verwertung an die Industrie abgegeben waren. Ihre Gesamtzahl soll demnach von maximal 225 auf 320 steigen. Ebenfalls bereits verkündet ist der Kauf von zusätzlich 130 Radpanzern Typ Boxer. Mit ihnen würde die Zahl der Fahrzeuge in dieser Klasse auf 1300 steigen. Überlegt wird außerdem, fast 200 der bereits ziemlich betagten Schützenpanzer Marder, die eigentlich vom Nachfolger Puma abgelöst werden sollten, weiter in der Truppe zu nutzen.“[17]
Selbstverständlich sind diese Kriegsgeräte nicht zum Nulltarif zu haben: Bis 2030 seien Investitionen im Gesamtvolumen von 130 Mrd. erforderlich, so von der Leyen. Legt man die bisher bis 2019 eingestellten Summen zugrunde, bedeutet dies zusätzliche Anschaffungen im Umfang von etwa 50 Mrd. Euro. Dies würde einem jährlichen Investitionsetat von ca. 9 Mrd. Euro jährlich entsprechen – die Rüstungsinvestitionen sollen also fast verdoppelt werden![18] Selbst wenn es gelänge, die Rüstungsinvestitionsquote, wie im Dialogpapier anvisiert, auf 20 Prozent zu erhöhen – was im Übrigen angesichts der möglichen Wiederaufstockung der Truppenzahl und den wachsenden Rekrutierungskosten recht fraglich ist –, würde das bei weitem nicht ausreichen, um den nun artikulierten Bedarf zu decken. Es liegt also auf der Hand, dass hier mehr oder weniger offen eine – nochmalige – Erhöhung des Rüstungsetats auf den Weg gebracht wird. Da trifft es sich aus von der Leyens Sicht besonders gut, dass ihr zufolge Finanzminister Wolfgang Schäuble „große Offenheit“ gegenüber ihren Forderungen an den Tag gelegt haben soll.[19]
Rüstungshaushalt: Schluck aus der Finanzpulle
Es lässt einen einigermaßen fassungslos zurück, wenn von der Leyen ihre jüngste Rüstungsoffensive u.a. damit begründet, der „große Nachholbedarf“ bei der Bundeswehr-Finanzierung müsse behoben werden.[20] Hier stellt sich doch ernsthaft die Frage, von was die Verteidigungsministerin spricht. Denn ungeachtet des seitens von Politik, Militär und Rüstungsindustrie sorgsam gepflegten Bildes einer drastisch unterfinanzierten Bundeswehr, sieht die Realität gänzlich anders aus.
Fakt ist: der Militärhaushalt stieg von (umgerechnet) 23,18 Mrd. Euro im Jahr 2000 selbst inflationsbereinigt um nahezu 25 Prozent auf etwa 33 Mrd. im Jahr 2015 an. Damit liegt der Haushalt zudem drastisch über dem – eigentlich verbindlich – vereinbarten Sparziel vom Juni 2010. Damals war festgelegt worden, dass alle Resorts bis 2014 zusammen 81,6 Mrd. Euro einsparen müssen und die Bundeswehr dazu 8,3 Mrd. Euro beitragen soll. Gemäß dem daran angelegten Bundeswehrplan sollte hierfür der Rüstungshaushalt bis 2014 auf 27,6 Mrd. Euro reduziert werden. Ganz offensichtlich wurde dieser Beschluss in der Folge dann stillschweigend kassiert. Obwohl also der offizielle Haushalt 2015 etwa 5,5 Mrd. über dem vereinbarten Sparziel lag, legte Finanzminister Wolfgang Schäuble im Frühjahr 2015 mit dem „Eckwerte-Papier“ noch einmal nach. Demnach soll der Etat 2016 auf 34,2 Mrd. Euro steigen, im Jahr darauf sollen es 34,74 Mrd. und 2018 dann 34,8 Mrd. sein, um 2019 schließlich 35 Mrd. zu umfassen.[21] Da nun scheinbar dennoch eine nochmalige Erhöhung ins Haus steht, drängt sich natürlich die Frage auf, wofür diese Kapazitäten für notwendig gehalten werden.
Kriegerische Verantwortung
Ganz den Schuh zieht es einem dann schlussendlich aus, dass von der Leyen ihre Rüstungsoffensive auch noch nassforsch damit begründet, sie sei erforderlich, damit Deutschland seiner „Verantwortung“ in der Welt gerecht werden könne; mit jenem Schlagwort also, das in jüngster Zeit zu einer kaum mehr verklausulierten Umschreibung für deutsche Weltmachtansprüche geworden ist: „Es ist klar für Alle, dass wenn wir äußere Sicherheit haben wollen und die derzeitige Lage zeigt, dass wenn Deutschland sicher sein soll, innerhalb der Bündnisse, dann müssen wir unseren Anteil an Verantwortung auch tragen und tatsächlich unsere Pflichten auch leisten, es ist klar, dann müssen wir auch investieren. […] Es geht nicht darum, ein Jahr mal eben einen großen Schluck aus der Pulle zu haben, darum geht es nicht, sondern dass es ganz wichtig ist, dass der Verteidigungsetat steigt, aber dann langfristig stetig oben bleibt.“[22]
Anschließend stellte die Journalistin Christiane Meier angesichts von 17 Bundeswehr-Einsätzen weltweit „von der Westsahara bis Afghanistan“ die Frage: „Müssen wir uns wirklich so groß aufstellen“? Die Antwort der Ministerin fiel überaus entschieden aus: „Aber ja! Das ist die Folge von Globalisierung. Das ist die Folge auch eines Landes, das eine große Bedeutung hat, politisch und ökonomisch, und das Verantwortung tragen muss, aber auch tragen will. Wir lernen doch gerade in der Flüchtlingskrise, dass wenn wir uns nicht kümmern […], dann kommen die Probleme zu uns vor die Haustür. Wenn wir uns nicht kümmern um Syrien oder Irak oder Afghanistan, wenn wir uns nicht kümmern in Afrika […], wenn wir unseren Beitrag nicht leisten, dann kommen die Probleme zu uns und dann wird es noch schlimmer. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen unseren Teil an Verantwortung tragen, dafür muss die Truppe gut ausgerüstet sein.“[23]
Es sei „richtig, wenn man die Probleme am Ort selber bekämpft“, so von der Leyen weiter, das beinhalte, wenn man „Stabilisierung in den fragilen Ländern mit herstellt“. Weiter sei es „richtig für die Menschen, ihre Perspektive in der Heimat zu schaffen, anstatt dass wir dann Erscheinungen haben, wie wir sie im Augenblick bei dieser epochalen Flüchtlingskrise sehen.“[24] Dass das Militär herzlich wenig dazu beigetragen hat, die von der Ministerin benannten Probleme zu beheben und sie in vielen Fällen überhaupt erst (mit)verursacht hat, wird natürlich ausgespart. Womit Deutschland wirklich seiner Verantwortung in der Welt halbwegs gerecht werden könnte wäre, wenn es z.B. eine Entwicklungsagenda im Umfang von mindestens 130 Mrd. Euro vorlegen würde – doch derlei Überlegungen stehen selbstredend nicht auf der „Agenda Rüstung“.
QUELLE