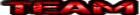Neue Initiativen aus der deutschen Entwicklungspolitik setzen auf Unternehmen und ihre Investitionen zur Minderung der Armut in afrikanischer Staaten. Eine gestern ausgestrahlte Arte-Doku widmet sich diesem Thema und stellt anhand von sieben Beispielen die Frage, ob die Profit-Interessen der Unternehmen mit der Armutsminderung vereinbar sind.
Ein Beispiel dieses unternehmerischen Ansatzes: In Kenia wird unter Mithilfe der deutschen Entwicklungszusammenarbeit Kartoffel-Saatgut hergestellt. Damit soll die Produktivität der Bauern steigen. Einziger Haken: Ein kleiner Sack Saatgut kostet 25 Euro – ein Preis, den sich afrikanische Kleinbauern kaum leisten können. Und wie bei der Gen-Baumwolle in Indien müssen sich die Bauern das Saatgut jede Saison neu kaufen. Es entsteht ein Abhängigkeit von den gleichen Agrarmultis, die das Programm mit technischem Know-How unterstützen. Zudem bestehe die massive Gefahr, dass mit dem importierten Saatgut auch Pflanzenkrankheiten importiert werden, so Marita Wiggerthale von Oxfam, was wiederum mehr Pestizid-Einsatz erfordert. Auch dadurch profitieren die Saatgut- und Pestizid-Hersteller. Kurz: Sie erschließen sich mit solchen Projekten einen neuen Markt, ohne Rücksicht darauf, ob die Projekte langfristig auch der lokalen Bevölkerung zugutekommen. Die zuständige Frau der GIZ sagt dazu: „… das [Projekt] war in einzelnen Fällen sehr erfolgreich, in anderen weniger. Und eigentlich müssen wir das jetzt den Bauern überlassen, was sie annehmen und nicht, da haben wir jetzt eigentlich keinen Einfluss drauf“. So kann man sich auch aus der Affäre ziehen.
Kleinbauern können Millionenstädte ernähren. Und bei der richtigen Förderung können sie auch höhere Profite erzielen und ihr Einkommen verbessern. Das würde besser helfen als Großinvestitionen und falsch ausgerichtete Öffentlich-Private-Partnerschaften.
QUELLE
Ein Beispiel dieses unternehmerischen Ansatzes: In Kenia wird unter Mithilfe der deutschen Entwicklungszusammenarbeit Kartoffel-Saatgut hergestellt. Damit soll die Produktivität der Bauern steigen. Einziger Haken: Ein kleiner Sack Saatgut kostet 25 Euro – ein Preis, den sich afrikanische Kleinbauern kaum leisten können. Und wie bei der Gen-Baumwolle in Indien müssen sich die Bauern das Saatgut jede Saison neu kaufen. Es entsteht ein Abhängigkeit von den gleichen Agrarmultis, die das Programm mit technischem Know-How unterstützen. Zudem bestehe die massive Gefahr, dass mit dem importierten Saatgut auch Pflanzenkrankheiten importiert werden, so Marita Wiggerthale von Oxfam, was wiederum mehr Pestizid-Einsatz erfordert. Auch dadurch profitieren die Saatgut- und Pestizid-Hersteller. Kurz: Sie erschließen sich mit solchen Projekten einen neuen Markt, ohne Rücksicht darauf, ob die Projekte langfristig auch der lokalen Bevölkerung zugutekommen. Die zuständige Frau der GIZ sagt dazu: „… das [Projekt] war in einzelnen Fällen sehr erfolgreich, in anderen weniger. Und eigentlich müssen wir das jetzt den Bauern überlassen, was sie annehmen und nicht, da haben wir jetzt eigentlich keinen Einfluss drauf“. So kann man sich auch aus der Affäre ziehen.
Weitere vorgestellte Projekte:
- Die Auslieferung von tiefgekühlten, importierten Dr. Oetker-Pizzen, finanziert durch Entwicklungshilfegelder.
- Der Anbau von Baumwolle in Sambia – ebenfalls unterstützt von Agrar-Multis. Traurigstes Zitat: „Wir arbeiten mit 120.000 Bauern, da können wir nicht jedem Schutzkleidung (für das Ausbringen von Pestiziden) zur Verfügung stellen“. Und die befragte Bäuerin sagt: „Wir sind vollkommen abhängig und müssen hart arbeiten, damit wir unsere Kredite zurückzahlen können, damit sie uns wieder Kredite geben können“.
- Die Palmöl- und Sojaproduktion in Sambia: „Entwicklungshilfe“, die zur Enteignung und Vertreibung der lokalen Bevölkerung und zur Waldrodung führte. Bei einem der Projekte nutzte der private Partner sogar eine Steueroase, um in Sambia noch nicht mal Steuern zahlen zu müssen
- Die Neue Allianz für Ernährungssicherheit in Tansania – ein G8 Projekt mit 220 Unternehmen, bei der sich einige Bauern in die sogenannte Vertragslandwirtschaft begeben und in vollkommener Abhängigkeit von ihren internationalen „Partnern“ leben. Ein Modell, das nicht selten in Schulden endet, was die Menschen wiederum dazu treibt, sich als Tagelöhner auf den Plantagen der Multis durchzuschlagen
- Und ein positives Beispiel eines deutschen Unternehmens, das Gewürzbauern auf Sansibar unterstützt. Dabei wird erfolgreich versucht, mehr auf Augenhöhe zu kooperieren und das Wissen der lokalen Akteure zu nutzen statt zuerst auf einen möglichst schnellen und hohen Profit zu zielen.
Kleinbauern können Millionenstädte ernähren. Und bei der richtigen Förderung können sie auch höhere Profite erzielen und ihr Einkommen verbessern. Das würde besser helfen als Großinvestitionen und falsch ausgerichtete Öffentlich-Private-Partnerschaften.
QUELLE