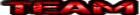Fragwürdige Reformen, gesenkte Anforderungen, Mauscheleien: Der Verfall des Hochschulwesens lässt die Professur zu einem Billigartikel werden.
Exzellenz der Hochschulen? Kriterien für Habilitation und Professur? Was jetzt an Anmerkungen zu Hochschulbildung und akademischen Titeln folgt, mag dem einen oder anderen etwas orchideenhaft vorkommen, um nicht zu sagen vollkommen unwichtig. Das stimmt jedoch nicht. Einmal handelt es sich bei der Titelvergabe wie der einer Professur um eine wissenschaftliche Tradition, die durchaus ehrwürdige und sehr verdienstvolle Seiten hat. Dann aber handelt es sich um die gerade anlässlich der aktuellen Bildungsdebatte wichtige Frage, wie die Universitäten ihr Lehrpersonal rekrutieren. Wie jemand Professor wird, sagt viel aus über den Zustand der sich selbst wieder vermehrt als Elite sehenden Bildungsstätten, die für Deutschland im internationalen Wettbewerb von eminenter Bedeutung sind.
Die Professur im Zeichen der Globalisierung
Von der europäischen Einigung und der Globalisierung wurden auch die universitären Einrichtungen betroffen. Unter dem Bologna-Prozess versteht man die „europaweite Harmonisierung von Studiengängen und -abschlüssen sowie auf internationale Mobilität der Studenten zielende transnationale Hochschulreform, die auf die Schaffung eines einheitlichen Europäischen Hochschulraums gerichtet ist“ [1]. Dieser Prozess hat zu einer Flut von neuen Studiengängen, Unterrichtsabläufen und Prüfungen geführt, mit daraus folgender erheblicher Überlastung des Lehrpersonals. Die Reform sollte jedoch kostenneutral erfolgen, wodurch u. a. die Diskrepanz zu der Tatsache immer deutlicher wurde, dass der auf Qualifikationsstellen arbeitende akademische Mittelbau – zum Beispiel Dozenten unterhalb der Lebensprofessur – meist nur zeitlich befristet und unspektakulär bezahlt beschäftigt war, also ohne dauerhafte materielle Absicherung blieb. Zu dieser Motivationsbremse kam noch das aufwendige und lange Verfahren, bis eine wissenschaftlich tätige Person Professor wird. Dem soll entgegengesteuert werden.
Mit erstaunlichem Tempo ändert beispielsweise der Fachbereich Medizin der Goethe-Universität Frankfurt seine Kriterien für die Verleihung der Bezeichnung „Außerplanmäßiger Professor“ bzw. „Außerplanmäßige Professorin“. Was sind „Außerplanmäßige Professoren“? Diese Professoren haben nicht unbedingt ein Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis an einer Hochschule und sind von den verbeamteten, also unbefristet beschäftigten Lehrstuhlinhabern in den Chefpositionen zu unterscheiden, den nach ihrer Gehaltsstufe sogenannten W3- Professoren, die im Haushaltsplan der Universität über eine oder mehrere Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter und einen Etat verfügen.
Zunächst einmal muss man aber für eine Professur habilitiert sein, d. h. die Lehrbefähigung haben. Anfang des neuen Jahrhunderts, also noch vor zehn Jahren, musste jemand, der habilitieren wollte, neben einer ganzen Reihe an Originalpublikationen in Zeitschriften, die ihre Artikel grundsätzlich einem sog. Peer-Review-Verfahren unterziehen, und bei deren Großteil man Erstautor, also der eigentliche Verfasser sein musste, auch noch eine Habilitationsschrift schreiben. Dabei handelte es sich um eine eigens für die Habilitation angefertigte Schrift von längerem Atem, deren Inhalt die ausführliche Darstellung einer wissenschaftlichen Neuerung sein sollte. Häufig wurde ein solches Opus in einem Fachverlag veröffentlicht. Ferner musste man eine ganze Reihe an Lehrveranstaltungen nachweisen können. Ein Habilitand musste natürlich promoviert sein, der Nachweis der Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten war damit bereits formal erbracht. In der Medizin wurde in aller Regel bis zum Ende des Studiums eine Doktorarbeit geschrieben und dann promoviert, die Zeit für Forschung, Lehre und Habilitation, meist neben der theoretisch-praktischen Ausbildung zum Facharzt, dauerte dann noch einmal mindestens fünf bis zehn Jahre.
Erst nach mindestens fünf weiteren Jahren der Bewährung in Forschung und Lehre konnte eine habilitierte Person einen Antrag auf Verleihung des Titels eines „Außerplanmäßigen Professors“ bzw. einer „Außerplanmäßigen Professorin“ stellen. Dafür musste noch einmal die gleiche Anzahl an Publikationen wie für die Habilitation nachgewiesen werden, die
Lehrtätigkeit musste ungebremst weitergegangen sein. Eine um ein Jahr vorzeitige Verleihung der Professur war nur bei Sonderleistungen wie der Organisation und Teilnahme an internationalen Studien möglich.
Der Sinn dieses aufwendigen Verfahrens war die Schaffung von hohen Exzellenzstandards durch nicht leicht zu überwindende Hürden. Ein Professor sollte für die Aufgabe vorbereitet werden, eigenverantwortlich und in Freiheit wissenschaftliche Forschung und Lehre (im Sinne des Humboldt’schen Bildungsideals) durchführen zu können. Die Freiheit ist heute vor allem durch die zunehmende Ökonomisierung der Universitäten bedroht, das Humboldt’sche Bildungsideal erscheint vielen politischen Entscheidungsträgern im Zuge der oben beschriebenen transnationalen Hochschulreform als nicht mehr zeitgemäß.
Zu den als nachteilig empfundenen Folgen der geschilderten Habilitationsprozedur gehörte für die Politik die Beobachtung, dass deutsche Professoren mit durchschnittlich über 40 Jahren bei ihrer Erstberufung deutlich älter sind als ihre ausländischen Kollegen. Hinzu kam eine zunehmende Abwanderung von wissenschaftlichen Begabungen unter anderem an US-amerikanische Universitäten. Um für den Weg zur regulären unbefristeten Professur eine vermeintlich unbürokratischeren, alternativen Weg anzubieten, wurde die Juniorprofessur eingeführt, für die nur die Promotion Voraussetzung ist. Nach drei Jahren gibt es eine Evaluation; falls sie positiv ausfällt, eine Verlängerung für noch einmal drei Jahre; bei weiterer positiver Evaluation kommt es zur Übernahme in eine W2-Professur, wenn es sich um eine Tenure-Track-Professur handelt. Tenure-Track bedeutet die Berufungsmöglichkeit auf eine Lebenszeitprofessur an derselben Hochschule ohne Ausschreibung. Unter anderem deshalb hat sich die Juniorprofessur aber nicht in der Breite bewährt, denn es sind nur 8 Prozent der Juniorprofessuren mit Tenure-Track ausgestattet. Ein wesentlicher Grund dafür wiederum ist die politische Absicht, die historisch eigentlich bewährte Habilitation beizubehalten. Also musste irgendwie bei ihr angesetzt werden.
Gesenkte Anforderungen
Bereits vor Jahren sind darum die Anforderungen für die Habilitation gesenkt worden. Das Verfassen einer Habilitationsschrift als Monographie ist in aller Regel weggefallen. Großbogig angelegtes Denken und Schreiben ist nicht mehr zeitgemäß; schematisch verfasste Standardartikel sind die Norm: Der Medizinprofessor verlernt zu schreiben. (In den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, weniger in den Geisteswissenschaften, ist Ähnliches zu beobachten: Statt des großen Wurfs eines Gelehrten sind Sammelbände die Regel geworden, in denen kurzatmige Beiträge vieler Autoren unter einer dehnbaren Überschrift zusammengefasst sind.) Ein weiterer Grund liegt in der Globalisierung. Wenn nämlich aus einer Habilitationsschrift nichts in internationalen Zeitschriften publiziert wurde, was leider vorkam, dämmerte ihr Inhalt still in einer Bibliothek vor sich hin: Deutsche wissenschaftliche Schriften liest praktisch niemand mehr. Es wurde aber nicht etwa verlangt, die Habilitationsschrift auf Englisch zu verfassen oder wenigstens eine Anzahl an englischen Artikeln aus ihr zu generieren. Nun genügt es, mehrere Publikationen, die thematisch irgendwie zusammengehören, nachträglich zusammenzufassen und über sie eine Art Resümee zu schreiben. Man nennt dieses kleinteilige Verfahren „kumulative Habilitation“.
Zwar wurde als Neuerung verlangt, dass die Publikationen nur in Journalen veröffentlicht worden sind, die ein gewisses Niveau haben. Es sollten Zeitschriften sein, deren Impact-Faktoren [2] im oberen Bereich der Zeitschriften des in Frage stehenden medizinischen Fachs gelegen haben. Viele Fächer haben aber nur Zeitschriften, deren Impact-Faktoren sehr eng zusammenliegen; man veröffentlicht also immer irgendwie hochrangig und die Forderung ist de facto eine Farce. Höchstens wurde damit die Publikation in deutschen Zeitschriften ausgerottet, da diese meist keinen hohen Impact-Faktor aufweisen; international zitiert werden eigentlich nur englische Journale. Jedenfalls ist die Neuerung von allen, die davon profitierten, als erhebliche Erleichterung empfunden worden.
Die Habilitation bedeutet, wie gesagt, eine Lehrbefähigung und keine Lehrbefugnis (venia legendi). Diese musste gesondert beantragt werden. Nur wer sich gleichzeitig verpflichtet hatte, weiterhin unentgeltlich zu lehren (was an sich schon skandalös ist), durfte sich nach Antragsgenehmigung „Privatdozent“ nennen. Wer habilitiert hatte, aber nicht weiter lehren wollte, war, wie ein Dekanatsangestellter des Universitätsklinikums Frankfurt einmal so unnachahmlich sagte, „nichts“. Daher hat der Fachbereich zeitgleich mit der Einführung der kumulativen Habilitation die Bezeichnung des „Dr. med. habil.“ inauguriert, um die Feststellung der Lehrbefähigung auch bei denjenigen Habilitierten zu unterstreichen, die keinen Antrag auf Lehrbefugnis und also auf das Recht zur Führung der Bezeichnung „Privatdozent“ gestellt haben. Mit anderen Worten ist die Erleichterung der Habilitation mit der Einführung eines neuen akademischen Grades belohnt worden.
Neue, dubiose Kriterien
Kürzlich sind für Mediziner auch die Kriterien für die Verleihung der Bezeichnung „Außerplanmäßiger Professor“ bzw. „Außerplanmäßige Professorin“ erleichtert worden, indem sie nun für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Betracht kommt, die sich nach der Promotion mindestens sechs Jahre in Forschung und Lehre bewährt haben und habilitiert sind oder eine Juniorprofessur innehatten. Es handelt sich also um eine zeitliche Verkürzung um mindestens die Hälfte. Es müssen insgesamt 24 Originalpublikationen, die einem Peer-Review-Verfahren unterzogen wurden, vorgelegt werden – wohlgemerkt nach der Promotion, nicht nach der Habilitation. Dabei müssen die Antragsteller bei mindestens 16 Arbeiten Erst- oder Letztautor sein. (Letztautor ist meist der Leiter der Arbeitsgruppe oder die Person, welche die tragende Idee hatte.) Unter diesen 16 Originalarbeiten mit Erst- oder Letztautorenschaften dürfen nun vier Originalarbeiten mit maximal unter zwei Autoren geteilter Erst- oder Letztautorenschaft sein.
Was aber ist eine geteilte Autorenschaft? Diese seltsame Neuerung berücksichtigt vordergründig die zunehmend interdisziplinäre Wissenschaft, bei welcher der Verfasser sich nicht gut genug mit einem Thema auskennt, um allein zu schreiben. Das führt jedoch zu der Merkwürdigkeit, dass eine einzige Publikation von zwei Leuten für deren jeweilige Habilitation berücksichtigt werden kann. Da hilft auch nicht, dass dieser Schwindel international üblich geworden ist. Letztlich ist es immer nur einer, der wirklich schreibt – der andere setzt sich dann wegen seines Anteils am Projekt mit drauf, aufgrund einer Absprache. Es wird also gemauschelt, und letztlich bedeutet das, dass man nur bei zwölf Arbeiten wirklich der wahre Erst- oder Letztautor sein muss. Sauber wäre die Lösung, dass von den zwei Wichtigsten eines Projekts einer Erstautor und der andere Letztautor ist. Da kommt aber folgende systemische Schwierigkeit zum Tragen, welche diese saubere Lösung verhindert: Die Letztautorenschaften, eigentlich der Platz für Arbeitsgruppenleiter oder Ideengeber, sind das ungeschriebene Privileg der Kliniks- und Abteilungsdirektoren, also der Lehrstuhlinhaber. Beim großen Rest der erforderlichen Arbeiten führt man sich gegenseitig als Mitautor an: Schreibst du mich bei dir drauf, schreib’ ich dich bei mir drauf – egal wie der reale Anteil an der Publikation wirklich war. Eine Hand wäscht eben die andere. Das wurde zwar häufig schon früher gemacht, je nach charakterlicher Konstitution. Heute ist es aber eine klare Folge der Vorgaben des Verfahrens, das ein solches Verhalten – also Mauscheleien und Gefälligkeiten – fördert.
Neuerdings können auch Lehr- und Forschungspreise einige Publikationen ersetzen; den talentierten Selbstvermarktern wird das nutzen. Schließlich sollen auch mindestens drei Promotionen betreut worden sein. Das war zwar meist sowieso schon der Fall, weil es zur Lehre gehört, aber dies festzuschreiben, ist eigentlich eine gute Idee. Und doch hat auch das wieder einen Beigeschmack. Dem Fachbereich geht es um das Ranking. Dazu muss man wissen, dass die Universitäten heute nach einigen Mess-Kriterien in eine Rangfolge zwischen Top und Hopp eingestuft werden, und zu den Kriterien zählt nun mal auch die Anzahl an Promotionen. Von der Qualität der Promotionen spricht niemand, weil die nur schwer zu messen ist. Die Maßnahme des Fachbereichs dient also der Erhöhung der reinen Zahl an Promotionen. Welche Folgen das hat, kann man sich leicht ausmalen.
Fazit: Ein Ausverkauf
Die hochschul- und wissenschaftspolitischen Gründe für diesen Ausverkauf der Professur sind nur zu bekannt. Es wird von Habilitierten und Professoren in Deutschland bald nur so wimmeln. Das wird gerne gekontert mit dem – allerdings falschen – Hinweis auf das Ausland. Dort gibt es zwar an den Universitäten oft mehr Professoren, aber dort gibt es nicht den W3-Professor, der die alleinige Budgethoheit hat. Der Professortitel hat dort eine ganz andere Bedeutung, dort gibt es flachere Hierarchien, mehr Verteilung der Budgetrechte. Eine echte Reform des Professorwesens in Deutschland wäre eine wichtige Tat und müsste am Lehrstuhlinhaber und seiner Budgethoheit ansetzen, aber sie müsste aus der W3-Professorenschaft kommen – und darum wird sie wohl nie kommen. Man muss sich nur die Zusammensetzung des Wissenschaftsrats oder der Hochschulrektorenkonferenz anschauen – lauter Lehrstuhlinhaber, die nicht an ihrem Stuhl sägen werden. Also bietet man viele schnellere und leichtere Professuren als Scheinlösung an für die, die überhaupt noch wissenschaftlich arbeiten wollen. Als Anreiz für den Nachwuchs, an dem Mangel herrscht. Quälen will sich nämlich kaum noch jemand. Die Universitäten müssen sich also attraktiver machen, um im Ranking mithalten zu können. Was ist diese Fata Morgana der Exzellenz aber wert?
Dass Deutschland sich bemüht, in wissenschaftlicher Forschung international Schritt zu halten, ist ebenso richtig wie der Versuch der Anpassung an internationale Standards. Allerdings gibt Deutschland eine Tradition auf, die seine größten wissenschaftlichen Erfolge überhaupt ermöglicht hat, und gleichzeitig ist es nicht in der Lage, bei den Reformen wirklich konsequent zu sein. Natürlich könnte es auch damit zufrieden sein, Erfindungen und Knowhow zu importieren wie dies die arabischen Ölstaaten tun. Mittelfristig wird sich aber in einem Land, das mangels natürlicher Ressourcen vor allem auf die gute Bildung und Ausbildung seiner Bevölkerung setzen muss, der Niedergang nicht vermeiden lassen. Darum hat es keinen Sinn, sich durch Scheinlösungen selbst Sand in die Augen zu streuen.
So wird, um bei unserem Frankfurter Beispiel zu bleiben, das dortige Universitätsklinikum zwar zu einem Scheinriesen der Wissenschaft und öffentlicher Beifall ist der Neuerung sicher. Auf der Webseite prangt dementsprechend als Selbstlob das FOCUS-Hochschulranking: Top 10 in Deutschland! Blickt man jedoch hinter die Kulissen, sieht man einen traurigen Verfall. Die Professur ist in Deutschland – relativ gesehen – zu einem Billigartikel geworden.
Natürlich darf man nicht alles schwarz in schwarz sehen. Hochbegabte Leute gab es immer und gibt es noch heute. Diese werden auch in Zukunft wissenschaftlich sehr gute Arbeit machen. Dennoch: In der Breite wird die Qualität sinken. Das ist schade. Denn sehr gute Leistungen brauchen einen soliden Mittelbau. Eine Palme wächst nicht auf dem nackten Stein; sie braucht schon etwas nährende Umgebung. So wird auch hier wie überall in der westlichen Gesellschaft die Schere zwischen „ganz viel“ und „ganz wenig“ weiter aufgehen; aber das „ganz wenig“ darf sich hochtrabende Titel geben. Heute ist ja offiziell überall nur noch von Qualität die Rede, alles ist Top, von Exzellenz wimmelt es nur so. Es wird schwerer, das Sein vom Schein zu unterscheiden. Es dürfte in Zukunft da immer weniger Professor drin sein, wo Professor drauf steht.
QUELLE
Exzellenz der Hochschulen? Kriterien für Habilitation und Professur? Was jetzt an Anmerkungen zu Hochschulbildung und akademischen Titeln folgt, mag dem einen oder anderen etwas orchideenhaft vorkommen, um nicht zu sagen vollkommen unwichtig. Das stimmt jedoch nicht. Einmal handelt es sich bei der Titelvergabe wie der einer Professur um eine wissenschaftliche Tradition, die durchaus ehrwürdige und sehr verdienstvolle Seiten hat. Dann aber handelt es sich um die gerade anlässlich der aktuellen Bildungsdebatte wichtige Frage, wie die Universitäten ihr Lehrpersonal rekrutieren. Wie jemand Professor wird, sagt viel aus über den Zustand der sich selbst wieder vermehrt als Elite sehenden Bildungsstätten, die für Deutschland im internationalen Wettbewerb von eminenter Bedeutung sind.
Die Professur im Zeichen der Globalisierung
Von der europäischen Einigung und der Globalisierung wurden auch die universitären Einrichtungen betroffen. Unter dem Bologna-Prozess versteht man die „europaweite Harmonisierung von Studiengängen und -abschlüssen sowie auf internationale Mobilität der Studenten zielende transnationale Hochschulreform, die auf die Schaffung eines einheitlichen Europäischen Hochschulraums gerichtet ist“ [1]. Dieser Prozess hat zu einer Flut von neuen Studiengängen, Unterrichtsabläufen und Prüfungen geführt, mit daraus folgender erheblicher Überlastung des Lehrpersonals. Die Reform sollte jedoch kostenneutral erfolgen, wodurch u. a. die Diskrepanz zu der Tatsache immer deutlicher wurde, dass der auf Qualifikationsstellen arbeitende akademische Mittelbau – zum Beispiel Dozenten unterhalb der Lebensprofessur – meist nur zeitlich befristet und unspektakulär bezahlt beschäftigt war, also ohne dauerhafte materielle Absicherung blieb. Zu dieser Motivationsbremse kam noch das aufwendige und lange Verfahren, bis eine wissenschaftlich tätige Person Professor wird. Dem soll entgegengesteuert werden.
Mit erstaunlichem Tempo ändert beispielsweise der Fachbereich Medizin der Goethe-Universität Frankfurt seine Kriterien für die Verleihung der Bezeichnung „Außerplanmäßiger Professor“ bzw. „Außerplanmäßige Professorin“. Was sind „Außerplanmäßige Professoren“? Diese Professoren haben nicht unbedingt ein Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis an einer Hochschule und sind von den verbeamteten, also unbefristet beschäftigten Lehrstuhlinhabern in den Chefpositionen zu unterscheiden, den nach ihrer Gehaltsstufe sogenannten W3- Professoren, die im Haushaltsplan der Universität über eine oder mehrere Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter und einen Etat verfügen.
Zunächst einmal muss man aber für eine Professur habilitiert sein, d. h. die Lehrbefähigung haben. Anfang des neuen Jahrhunderts, also noch vor zehn Jahren, musste jemand, der habilitieren wollte, neben einer ganzen Reihe an Originalpublikationen in Zeitschriften, die ihre Artikel grundsätzlich einem sog. Peer-Review-Verfahren unterziehen, und bei deren Großteil man Erstautor, also der eigentliche Verfasser sein musste, auch noch eine Habilitationsschrift schreiben. Dabei handelte es sich um eine eigens für die Habilitation angefertigte Schrift von längerem Atem, deren Inhalt die ausführliche Darstellung einer wissenschaftlichen Neuerung sein sollte. Häufig wurde ein solches Opus in einem Fachverlag veröffentlicht. Ferner musste man eine ganze Reihe an Lehrveranstaltungen nachweisen können. Ein Habilitand musste natürlich promoviert sein, der Nachweis der Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten war damit bereits formal erbracht. In der Medizin wurde in aller Regel bis zum Ende des Studiums eine Doktorarbeit geschrieben und dann promoviert, die Zeit für Forschung, Lehre und Habilitation, meist neben der theoretisch-praktischen Ausbildung zum Facharzt, dauerte dann noch einmal mindestens fünf bis zehn Jahre.
Erst nach mindestens fünf weiteren Jahren der Bewährung in Forschung und Lehre konnte eine habilitierte Person einen Antrag auf Verleihung des Titels eines „Außerplanmäßigen Professors“ bzw. einer „Außerplanmäßigen Professorin“ stellen. Dafür musste noch einmal die gleiche Anzahl an Publikationen wie für die Habilitation nachgewiesen werden, die
Lehrtätigkeit musste ungebremst weitergegangen sein. Eine um ein Jahr vorzeitige Verleihung der Professur war nur bei Sonderleistungen wie der Organisation und Teilnahme an internationalen Studien möglich.
Der Sinn dieses aufwendigen Verfahrens war die Schaffung von hohen Exzellenzstandards durch nicht leicht zu überwindende Hürden. Ein Professor sollte für die Aufgabe vorbereitet werden, eigenverantwortlich und in Freiheit wissenschaftliche Forschung und Lehre (im Sinne des Humboldt’schen Bildungsideals) durchführen zu können. Die Freiheit ist heute vor allem durch die zunehmende Ökonomisierung der Universitäten bedroht, das Humboldt’sche Bildungsideal erscheint vielen politischen Entscheidungsträgern im Zuge der oben beschriebenen transnationalen Hochschulreform als nicht mehr zeitgemäß.
Zu den als nachteilig empfundenen Folgen der geschilderten Habilitationsprozedur gehörte für die Politik die Beobachtung, dass deutsche Professoren mit durchschnittlich über 40 Jahren bei ihrer Erstberufung deutlich älter sind als ihre ausländischen Kollegen. Hinzu kam eine zunehmende Abwanderung von wissenschaftlichen Begabungen unter anderem an US-amerikanische Universitäten. Um für den Weg zur regulären unbefristeten Professur eine vermeintlich unbürokratischeren, alternativen Weg anzubieten, wurde die Juniorprofessur eingeführt, für die nur die Promotion Voraussetzung ist. Nach drei Jahren gibt es eine Evaluation; falls sie positiv ausfällt, eine Verlängerung für noch einmal drei Jahre; bei weiterer positiver Evaluation kommt es zur Übernahme in eine W2-Professur, wenn es sich um eine Tenure-Track-Professur handelt. Tenure-Track bedeutet die Berufungsmöglichkeit auf eine Lebenszeitprofessur an derselben Hochschule ohne Ausschreibung. Unter anderem deshalb hat sich die Juniorprofessur aber nicht in der Breite bewährt, denn es sind nur 8 Prozent der Juniorprofessuren mit Tenure-Track ausgestattet. Ein wesentlicher Grund dafür wiederum ist die politische Absicht, die historisch eigentlich bewährte Habilitation beizubehalten. Also musste irgendwie bei ihr angesetzt werden.
Gesenkte Anforderungen
Bereits vor Jahren sind darum die Anforderungen für die Habilitation gesenkt worden. Das Verfassen einer Habilitationsschrift als Monographie ist in aller Regel weggefallen. Großbogig angelegtes Denken und Schreiben ist nicht mehr zeitgemäß; schematisch verfasste Standardartikel sind die Norm: Der Medizinprofessor verlernt zu schreiben. (In den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, weniger in den Geisteswissenschaften, ist Ähnliches zu beobachten: Statt des großen Wurfs eines Gelehrten sind Sammelbände die Regel geworden, in denen kurzatmige Beiträge vieler Autoren unter einer dehnbaren Überschrift zusammengefasst sind.) Ein weiterer Grund liegt in der Globalisierung. Wenn nämlich aus einer Habilitationsschrift nichts in internationalen Zeitschriften publiziert wurde, was leider vorkam, dämmerte ihr Inhalt still in einer Bibliothek vor sich hin: Deutsche wissenschaftliche Schriften liest praktisch niemand mehr. Es wurde aber nicht etwa verlangt, die Habilitationsschrift auf Englisch zu verfassen oder wenigstens eine Anzahl an englischen Artikeln aus ihr zu generieren. Nun genügt es, mehrere Publikationen, die thematisch irgendwie zusammengehören, nachträglich zusammenzufassen und über sie eine Art Resümee zu schreiben. Man nennt dieses kleinteilige Verfahren „kumulative Habilitation“.
Zwar wurde als Neuerung verlangt, dass die Publikationen nur in Journalen veröffentlicht worden sind, die ein gewisses Niveau haben. Es sollten Zeitschriften sein, deren Impact-Faktoren [2] im oberen Bereich der Zeitschriften des in Frage stehenden medizinischen Fachs gelegen haben. Viele Fächer haben aber nur Zeitschriften, deren Impact-Faktoren sehr eng zusammenliegen; man veröffentlicht also immer irgendwie hochrangig und die Forderung ist de facto eine Farce. Höchstens wurde damit die Publikation in deutschen Zeitschriften ausgerottet, da diese meist keinen hohen Impact-Faktor aufweisen; international zitiert werden eigentlich nur englische Journale. Jedenfalls ist die Neuerung von allen, die davon profitierten, als erhebliche Erleichterung empfunden worden.
Die Habilitation bedeutet, wie gesagt, eine Lehrbefähigung und keine Lehrbefugnis (venia legendi). Diese musste gesondert beantragt werden. Nur wer sich gleichzeitig verpflichtet hatte, weiterhin unentgeltlich zu lehren (was an sich schon skandalös ist), durfte sich nach Antragsgenehmigung „Privatdozent“ nennen. Wer habilitiert hatte, aber nicht weiter lehren wollte, war, wie ein Dekanatsangestellter des Universitätsklinikums Frankfurt einmal so unnachahmlich sagte, „nichts“. Daher hat der Fachbereich zeitgleich mit der Einführung der kumulativen Habilitation die Bezeichnung des „Dr. med. habil.“ inauguriert, um die Feststellung der Lehrbefähigung auch bei denjenigen Habilitierten zu unterstreichen, die keinen Antrag auf Lehrbefugnis und also auf das Recht zur Führung der Bezeichnung „Privatdozent“ gestellt haben. Mit anderen Worten ist die Erleichterung der Habilitation mit der Einführung eines neuen akademischen Grades belohnt worden.
Neue, dubiose Kriterien
Kürzlich sind für Mediziner auch die Kriterien für die Verleihung der Bezeichnung „Außerplanmäßiger Professor“ bzw. „Außerplanmäßige Professorin“ erleichtert worden, indem sie nun für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Betracht kommt, die sich nach der Promotion mindestens sechs Jahre in Forschung und Lehre bewährt haben und habilitiert sind oder eine Juniorprofessur innehatten. Es handelt sich also um eine zeitliche Verkürzung um mindestens die Hälfte. Es müssen insgesamt 24 Originalpublikationen, die einem Peer-Review-Verfahren unterzogen wurden, vorgelegt werden – wohlgemerkt nach der Promotion, nicht nach der Habilitation. Dabei müssen die Antragsteller bei mindestens 16 Arbeiten Erst- oder Letztautor sein. (Letztautor ist meist der Leiter der Arbeitsgruppe oder die Person, welche die tragende Idee hatte.) Unter diesen 16 Originalarbeiten mit Erst- oder Letztautorenschaften dürfen nun vier Originalarbeiten mit maximal unter zwei Autoren geteilter Erst- oder Letztautorenschaft sein.
Was aber ist eine geteilte Autorenschaft? Diese seltsame Neuerung berücksichtigt vordergründig die zunehmend interdisziplinäre Wissenschaft, bei welcher der Verfasser sich nicht gut genug mit einem Thema auskennt, um allein zu schreiben. Das führt jedoch zu der Merkwürdigkeit, dass eine einzige Publikation von zwei Leuten für deren jeweilige Habilitation berücksichtigt werden kann. Da hilft auch nicht, dass dieser Schwindel international üblich geworden ist. Letztlich ist es immer nur einer, der wirklich schreibt – der andere setzt sich dann wegen seines Anteils am Projekt mit drauf, aufgrund einer Absprache. Es wird also gemauschelt, und letztlich bedeutet das, dass man nur bei zwölf Arbeiten wirklich der wahre Erst- oder Letztautor sein muss. Sauber wäre die Lösung, dass von den zwei Wichtigsten eines Projekts einer Erstautor und der andere Letztautor ist. Da kommt aber folgende systemische Schwierigkeit zum Tragen, welche diese saubere Lösung verhindert: Die Letztautorenschaften, eigentlich der Platz für Arbeitsgruppenleiter oder Ideengeber, sind das ungeschriebene Privileg der Kliniks- und Abteilungsdirektoren, also der Lehrstuhlinhaber. Beim großen Rest der erforderlichen Arbeiten führt man sich gegenseitig als Mitautor an: Schreibst du mich bei dir drauf, schreib’ ich dich bei mir drauf – egal wie der reale Anteil an der Publikation wirklich war. Eine Hand wäscht eben die andere. Das wurde zwar häufig schon früher gemacht, je nach charakterlicher Konstitution. Heute ist es aber eine klare Folge der Vorgaben des Verfahrens, das ein solches Verhalten – also Mauscheleien und Gefälligkeiten – fördert.
Neuerdings können auch Lehr- und Forschungspreise einige Publikationen ersetzen; den talentierten Selbstvermarktern wird das nutzen. Schließlich sollen auch mindestens drei Promotionen betreut worden sein. Das war zwar meist sowieso schon der Fall, weil es zur Lehre gehört, aber dies festzuschreiben, ist eigentlich eine gute Idee. Und doch hat auch das wieder einen Beigeschmack. Dem Fachbereich geht es um das Ranking. Dazu muss man wissen, dass die Universitäten heute nach einigen Mess-Kriterien in eine Rangfolge zwischen Top und Hopp eingestuft werden, und zu den Kriterien zählt nun mal auch die Anzahl an Promotionen. Von der Qualität der Promotionen spricht niemand, weil die nur schwer zu messen ist. Die Maßnahme des Fachbereichs dient also der Erhöhung der reinen Zahl an Promotionen. Welche Folgen das hat, kann man sich leicht ausmalen.
Fazit: Ein Ausverkauf
Die hochschul- und wissenschaftspolitischen Gründe für diesen Ausverkauf der Professur sind nur zu bekannt. Es wird von Habilitierten und Professoren in Deutschland bald nur so wimmeln. Das wird gerne gekontert mit dem – allerdings falschen – Hinweis auf das Ausland. Dort gibt es zwar an den Universitäten oft mehr Professoren, aber dort gibt es nicht den W3-Professor, der die alleinige Budgethoheit hat. Der Professortitel hat dort eine ganz andere Bedeutung, dort gibt es flachere Hierarchien, mehr Verteilung der Budgetrechte. Eine echte Reform des Professorwesens in Deutschland wäre eine wichtige Tat und müsste am Lehrstuhlinhaber und seiner Budgethoheit ansetzen, aber sie müsste aus der W3-Professorenschaft kommen – und darum wird sie wohl nie kommen. Man muss sich nur die Zusammensetzung des Wissenschaftsrats oder der Hochschulrektorenkonferenz anschauen – lauter Lehrstuhlinhaber, die nicht an ihrem Stuhl sägen werden. Also bietet man viele schnellere und leichtere Professuren als Scheinlösung an für die, die überhaupt noch wissenschaftlich arbeiten wollen. Als Anreiz für den Nachwuchs, an dem Mangel herrscht. Quälen will sich nämlich kaum noch jemand. Die Universitäten müssen sich also attraktiver machen, um im Ranking mithalten zu können. Was ist diese Fata Morgana der Exzellenz aber wert?
Dass Deutschland sich bemüht, in wissenschaftlicher Forschung international Schritt zu halten, ist ebenso richtig wie der Versuch der Anpassung an internationale Standards. Allerdings gibt Deutschland eine Tradition auf, die seine größten wissenschaftlichen Erfolge überhaupt ermöglicht hat, und gleichzeitig ist es nicht in der Lage, bei den Reformen wirklich konsequent zu sein. Natürlich könnte es auch damit zufrieden sein, Erfindungen und Knowhow zu importieren wie dies die arabischen Ölstaaten tun. Mittelfristig wird sich aber in einem Land, das mangels natürlicher Ressourcen vor allem auf die gute Bildung und Ausbildung seiner Bevölkerung setzen muss, der Niedergang nicht vermeiden lassen. Darum hat es keinen Sinn, sich durch Scheinlösungen selbst Sand in die Augen zu streuen.
So wird, um bei unserem Frankfurter Beispiel zu bleiben, das dortige Universitätsklinikum zwar zu einem Scheinriesen der Wissenschaft und öffentlicher Beifall ist der Neuerung sicher. Auf der Webseite prangt dementsprechend als Selbstlob das FOCUS-Hochschulranking: Top 10 in Deutschland! Blickt man jedoch hinter die Kulissen, sieht man einen traurigen Verfall. Die Professur ist in Deutschland – relativ gesehen – zu einem Billigartikel geworden.
Natürlich darf man nicht alles schwarz in schwarz sehen. Hochbegabte Leute gab es immer und gibt es noch heute. Diese werden auch in Zukunft wissenschaftlich sehr gute Arbeit machen. Dennoch: In der Breite wird die Qualität sinken. Das ist schade. Denn sehr gute Leistungen brauchen einen soliden Mittelbau. Eine Palme wächst nicht auf dem nackten Stein; sie braucht schon etwas nährende Umgebung. So wird auch hier wie überall in der westlichen Gesellschaft die Schere zwischen „ganz viel“ und „ganz wenig“ weiter aufgehen; aber das „ganz wenig“ darf sich hochtrabende Titel geben. Heute ist ja offiziell überall nur noch von Qualität die Rede, alles ist Top, von Exzellenz wimmelt es nur so. Es wird schwerer, das Sein vom Schein zu unterscheiden. Es dürfte in Zukunft da immer weniger Professor drin sein, wo Professor drauf steht.
QUELLE